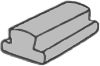Teil 1: Methoden zur Untersuchung des Nervensystems
5.1. Methoden zur Visualisierung und Stimulation des lebenden menschlichen Gehirns
Bis in die frühen 70er Jahre des 20. Jahrhunderts war die biopsychologische Forschung dadurch behindert, dass es nicht möglich war, Bilder von dem Organ zu machen, dem das Hauptinteresse galt: dem lebenden menschlichen Gehirn. Herkömmliche Röntgenaufnahmen sind hierfür nahezu nutzlos. Bei einer Röntgenaufnahme durchdringt ein Röntgenstrahl ein Objekt und trifft dann auf eine Fotoplatte. Jedes Molekül, das der Röntgenstrahl durchdringt, absorbiert einen Teil der Strahlung, und somit erreichen nur die nichtabsorbierten Anteile des Strahls die Fotoplatte. Die Röntgenfotografie kann daher zur Beschreibung innerer Strukturen genutzt werden, die sich von ihrer Umgebung erheblich in dem Ausmaß unterscheiden, in dem sie Röntgenstrahlen absorbieren – z. B. ein Revolver in einem Koffer voller Kleidung oder ein Knochen im Fleisch. Wenn dagegen ein Röntgenstrahl die zahlreichen, einander überlappenden Strukturen des Gehirns durchdrungen hat, die sich nur leicht in ihrer Fähigkeit Röntgenstrahlen zu absorbieren unterscheiden, liefert er nur wenige Informationen über die Gestalt der einzelnen durchdrungenen Strukturen.
5.1.1 Röntgenkontrastuntersuchung
Die konventionelle Röntgenaufnahme ist zur Visualisierung des Gehirns also nicht brauchbar, die Röntgenkontrastuntersuchung hingegen schon. Bei der Röntgenkontrastuntersuchung wird eine Substanz in einen Bereich des Körpers injiziert, die Röntgenstrahlen entweder stärker oder schwächer absorbiert als das umliegende Gewebe. Die injizierte Substanz erhöht also für die Röntgenaufnahme den Kontrast zwischen
Bei einer bestimmten Form der Röntgenkontrastuntersuchung, der zerebralen Angiografie, wird ein Kontrastmittel in eine zerebrale Arterie infundiert, um das zerebrale Kreislaufsystem sichtbar zu machen (siehe ▶ Abbildung 5.1). Zerebrale Angiogramme sind zur Lokalisation vaskulärer Schädigungen äußerst nützlich. Die Verschiebung von Blutgefäßen weg von ihrer normalen Position kann aber auch die Lage eines Tumors anzeigen.
► Abbildung 5.1:
5.1.2 Computertomografie
In den frühen 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde die Erforschung des lebenden menschlichen Gehirns durch die Einführung der Computertomografie revolutioniert. Die Computertomografie (CT) ist ein computergestütztes Röntgenverfahren, das zur Visualisierung des Gehirns und anderer innerer Strukturen des lebenden Körpers verwendet werden kann. Während einer zerebralen Computertomografie liegt der neurologische Patient mit seinem Kopf im Zentrum eines großen Zylinders, wie in ▶ Abbildung 5.2 dargestellt. Auf der einen Seite des Zylinders befi ndet sich eine Röntgenröhre, die einen Röntgenstrahl durch den Kopf des Patienten zu einem Röntgenstrahlendetektor projiziert, der an der gegenüberliegenden Seite befestigt ist. Die Röntgenröhre und der Detektor rotieren automatisch auf einer Ebene des Gehirns um den Kopf des Patienten und erstellen dabei viele einzelne Röntgenbilder. Die in jeder Röntgenaufnahme enthaltenen dürftigen Informationen werden durch einen Computer zusammengesetzt, um einen CT-Scan eines horizontalen Schnitts durch das Gehirn zu erzeugen. Anschließend werden die Röntgenröhre und der Detektor entlang der Körperachse des Patienten zu einer anderen Ebene des Gehirns bewegt, und der Vorgang wird wiederholt. Normalerweise erhält man acht oder neun horizontale Gehirnschnitte von einem Patienten, die gemeinsam eine dreidimensionale Darstellung des Gehirns erlauben.
► Abbildung 5.2: Die Computertomografie (CT) verwendet Röntgenstrahlen, um einen CT-Scan des Gehirns zu erzeugen .
5.1.3 Magnetresonanztomografie
Der Erfolg der Computertomografie stimulierte die Entwicklung anderer Techniken, um Bilder vom Inneren des lebenden Körpers zu erhalten. Zu diesen Techniken gehört die Magnetresonanztomografie (MRT) – ein Verfahren, bei dem hochauflösende Bilder über die Messung von Wellen erstellt werden, die Wasserstoffatome ausstrahlen, wenn sie über Radiowellen in einem Magnetfeld erregt werden. Die MRT liefert deutlichere Bilder vom Gehirn als die CT. Einen farbkodierten, zweidimensionalen MRT-Scan der mittleren Sagittalebene des Gehirns zeigt ▼ Abbildung 5.3.
▼Abbildung 5.3: Ein farbverstärkter MRT-Scan der mittleren Sagittalebene des Gehirns .
▲ Abbildung 5.4: Die strukturelle MRT kann dreidimensionale Bilder des gesamten Gehirns erzeugen. (Mit freundlicher Genehmigung von Bruce Foster und Robert Hare, University of British Columbia)
Die MRT liefert eine relativ hohe räumliche Auflösung (die Möglichkeit, Unterschiede in der räumlichen Lage fest- und darzustellen) und kann zusätzlich dreidimensionale Bilder erzeugen. ▲ Abbildung 5.4 zeigt einen dreidimensionalen MRT-Scan, ▼ Abbildung 5.5 zweidimensionale MRT-Scans eines Patienten mit einem wachsenden Tumor.
▼ Abbildung 5.5: Die strukturelle MRT kann auch dazu verwendet werden, zweidimensionale Gehirnschnittbilder zu erstellen. Der MRT-Scan links zeigt einen Tumor kurz nach einer Bestrahlungstherapie, der MRT-Scan rechts denselben Tumor einige Wochen später. Es ist klar erkennbar, dass der Tumor weiter wächst. Die Ventrikel sind gelb umrandet, der Tumor rot. (Adaptiert aus Calmon et al., 1998; mit freundlicher Genehmigung von Neil Robert, University of Liverpool)
5.1.4 Positronenemissionstomografie
Die Positronenemissionstomografie (PET) war die erste bildgebende Technik, die Bilder von der Gehirnaktivität lieferte (funktionelle Bildgebung des Gehirns). Bei einer verbreiteten Anwendung der PET wird radioaktive 2-Desoxyglukose (2-DG) in die Karotisarterie (die Halsarterie, die die ipsilaterale zerebrale Hemisphäre versorgt) injiziert. Aufgrund ihrer Ähnlichkeit zur Glukose, der wichtigsten Energiequelle des Gehirnstoffwechsels, wird die 2-Desoxyglukose schnell von aktiven (energieverbrauchenden) Neuronen aufgenommen. Allerdings kann die 2-Desoxyglukose, anders als die Glukose, nicht metabolisiert werden und sammelt sich daher in aktiven Neuronen oder in assoziierten Astrozyten (Barros, Porras & Bittner, 2005) an, bis sie allmählich zerfällt. Jeder PET-Scan liefert ein Abbild der Stärke der Radioaktivität (angezeigt über eine Farbkodierung) in verschiedenen Teilen einer horizontalen Ebene des Gehirns. Wenn also ein PET-Scan von einem Patienten angefertigt wird, der für ungefähr 30 Sekunden nach der 2-DG-Injektion mit einer Aktivität, wie z. B. Lesen, beschäftigt ist, so zeigt der resultierende Scan die während dieser 30 Sekunden am stärksten aktiven Bereiche einer Gehirnebene an (siehe ▶ Abbildung 5.6).
Aus Abbildung 5.6 lässt sich entnehmen, dass PETScans keine echten Bilder des Gehirns sind. Jeder PETScan ist lediglich eine farbige Karte der Stärke der Radioaktivität in jedem der winzigen kubischen Voxel („volume pixel“), aus denen sich der Scan zusammensetzt. Indem der Scan einem Gehirnbild überlagert wird, kann abgeschätzt werden, zu welcher Gehirnstruktur jeder Voxel gehört
▶
5.1.5 Funktionelle MRT
Die MRT-Technologie wird auch verwendet, um funktionelle Bilder des Gehirns zu erzeugen. In der Tat hat sich die funktionelle MRT zum einflussreichsten Werkzeug der Kognitiven Neurowissenschaften entwickelt (Jäncke, 2005; Poldrack, 2008) und wird heute auch häufig für die medizinische Diagnostik genutzt (Holdsworth & Bammer, 2008).
Die funktionelle MRT (fMRT) erzeugt Bilder, die eine Zunahme im Sauerstofffluss im Blut zu aktiven Bereichen des Gehirns darstellen. Das Verfahren der fMRT basiert auf zwei Eigenschaften des oxygenierten Blutes (siehe Jäncke, 2005; Raichle & Mintun, 2006). Erstens nehmen aktive Gehirnregionen mehr oxygeniertes Blut auf, als sie eigentlich brauchen, sodass sich oxygeniertes Blut in aktiven Gehirnregionen ansammelt. Zweitens hat oxygeniertes Blut magnetische Eigenschaften (das Oxygen beeinflusst die Wirkung von Magnetfeldern auf Eisen im Blut). Das durch fMRT aufgezeichnete Signal wird BOLD-Signal („blood-oxygen- level-dependent signal“) genannt.
Die funktionelle MRT hat gegenüber der PET vier Vorteile: (1) Dem Probanden muss nichts injiziert werden; (2) sie liefert in einem Bild sowohl strukturelle als auch funktionelle Informationen; (3) ihre räumliche Auflösung ist besser; und (4) sie kann verwendet werden, um dreidimensionale Bilder der Aktivität des gesamten Gehirns zu erzeugen. Funktionelle MRTScans zeigt beispielhaft ▶ Abbildung 5.7.
Es ist wichtig, sich von den beeindruckenden Bildern und der Technik nicht übermäßig „einwickeln“ zu lassen. Die Bilder werden oft präsentiert – vor allem in den Medien und in allgemeinen Lehrbüchern – als ob sie die neuronale Aktivität des menschlichen Gehirns darstellen würden. Das tun sie aber nicht. Sie zeigen das BOLD-Signal, und der Zusammenhang zwischen BOLD-Signal und neuronaler Aktivität ist komplex und veränderlich (siehe Bartels, Logothetis & Moutoussis, 2008; Ekstrom et al., 2009; Goense & Logothetis, 2008; Shmuel & Leopold, 2009; Zhang et al., 2009). Außerdem ist die fMRT-Technik zur Erfassung vieler neuronaler Aktivitäten zu langsam. Es dauert zwei bis drei Sekunden, um ein fMRT-Bild zu erzeugen, aber viele neuronale Antworten, wie z. B Aktionspotentiale, ereignen sich innerhalb von Millisekunden (siehe Dobbs, 2005; Poldrack, 2 008).
▶ Abbildung 5.7: Funktionelle Magnet-Resonanz-Tomografie (fMRT). Die Bilder veranschaulichen die Gebiete des Cortex, die verstärkt aktiv waren, als die Probanden Gesichter mit Schmerzausdruck sahen, im Vergleich zu einer Kontrollbedingung, in der die Probanden neutrale Gesichter betrachteten (Cheetham et al., 2009). Die fMRT Bilder hier zeigen Schnitte durch das Gehirn (alternativ können Bilder von der Oberflächenaktivität erzeugt werden). Die Lokation der Schnitte wird durch ihre Position in einem dreidimensionalen Referenzsystem (mit den Achsen x, y und z) definiert; y definiert die Position des Frontalschnitts, z des Horizontalschnitts und x des Sagittalschnitts; PFC = präfrontaler Cortex. (Mit freundlicher Genehmigung von Marcus Cheetham und Lutz Jäncke, Abteilung für Neuropsychologie, Universität Zürich, Schweiz)
Die MRT-Technologie wird auch verwendet, um funktionelle Bilder des Gehirns zu erzeugen. In der Tat hat sich die funktionelle MRT zum einflussreichsten Werkzeug der Kognitiven Neurowissenschaften entwickelt (Jäncke, 2005; Poldrack, 2008) und wird heute auch häufig für die medizinische Diagnostik genutzt (Holdsworth & Bammer, 2008).
5.1.6 Funktionelle Nah-Infrarotspektroskopie (fNIRS)
Die funktionelle Nah-Infrarotspektroskopie (fNIRS) ist ein optisches bildgebendes Verfahren, bei dem, ähnlich wie bei der fMRT, Veränderungen im Sauerstoffgehalt des Blutes im Gehirn durch die Schädeldecke gemessen werden. Die fNIRS basiert darauf, dass infrarotes Licht (zwischen 600 und 1000 nm) biologisches Gewebe relativ gut durchdringen kann und dass oxygeniertes und desoxygeniertes Hämoglobin in diesem Spektralbereich charakteristische Absorptionsspektren haben. Basierend auf diesen Gegebenheiten lassen sich Änderungen in der Konzentration des oxygenierten und desoxygenierten Blutes in bestimmten Hirnarealen bestimmen und so, wie bei der fMRT, Rückschlüsse auf Aktivitäten in diesen Gehirnarealen ziehen. Vorteile gegenüber der fMRT sind deutlich geringere Kosten, geringere Bewegungseinschränkung der Probanden und Unschädlichkeit, was einen ortsflexiblen Einsatz und auch die Untersuchung von Kindern erlaubt. Nachteile sind, dass das infrarote Licht nur wenige Zentimeter in das Gehirn eindringen kann, sodass Blutflussänderungen nur in oberflächennahen Gehirngebieten erfasst werden können und die räumliche Auflösung geringer ist. fNIRS-Messungen sind reliabel und valide (siehe Plichta et al., 2006, 2007) und eignen sich beispielsweise zur Untersuchung der Frontalcortexaktivität bei Gesunden und Patienten (z. B. Herrmann et al., 2008).
5.1.7 Transkranielle Magnetstimulation
PET, fMRT und MEG (s. u.) haben es den kognitiven Neurowissenschaftlern ermöglicht, Bilder von der Aktivität des menschlichen Gehirns zu erzeugen. Diese Methoden haben aber alle dieselbe Schwäche: Sie können zwar eine Korrelation zwischen der Gehirnaktivität und der kognitiven Aktivität aufzeigen, aber sie können nicht beweisen, dass die Gehirnaktivität und die kognitive Aktivität in einem kausalen Zusammenhang stehen (Rorden & Karnath, 2004; Sack, 2006). Zum Beispiel kann ein bildgebendes Verfahren zeigen, dass der cinguläre Cortex aktiv ist, wenn menschliche Probanden aufwühlende Fotografi en betrachten, aber es kann nicht beweisen, dass die Aktivität im cingulären Cortex das emotionale Empfinden bedingt – für den beobachteten Zusammenhang gibt es eine Reihe von Erklärungen. Eine Möglichkeit zu prüfen, ob der cinguläre Cortex tatsächlich für das emotionale Empfinden verantwortlich ist, bestünde darin, Personen zu untersuchen, die keinen funktionierenden cingulären Cortex haben – beispielsweise Personen mit einer Läsion des cingulären Cortex oder gesunde Personen, bei denen der cinguläre Cortex irgendwie „ausgeschaltet“ ist. Die transkranielle Magnetstimulation ist eine Möglichkeit, dies zu erreichen.
Die transkranielle Magnetstimulation (TMS) ist ein Verfahren, mit dem durch eine über dem Schädel positionierte Spule ein Magnetfeld erzeugt wird, das die Aktivität in einem Cortexbereich darunter verändern kann (siehe Fitzpatrick & Rothman, 2000; Pascual-Leone, Walsh & Rothwell, 2000). Beispielsweise kann durch die Magnetstimulation ein bestimmter Teil des Gehirns „abgeschaltet“ werden, und während dieser Zeit können die Auswirkungen auf Kognition und Verhalten untersucht werden. Obwohl grundlegenden Fragen über die Auswirkungen, die Wirkungstiefe und die Mechanismen der neuronalen Unterbrechung noch unbeantwortet sind (siehe Allen et al., 2007; Bestmann, 2007; Wagner, Valero-Cabre & Pascual-Leone, 2007), wird die TMS häufig eingesetzt, um das Problem von Bildgebungsstudien bei der Aufdeckung kausaler Zusammenhänge zu umgehen.